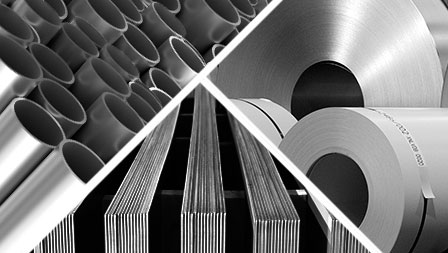Arbeitswelt Stahl: Stahlindustrie: Viele Aufträge – zu wenig Personal

Stahl ist ein vielseitiger, moderner Werkstoff, der weltweit boomt. Bei allem Erfolg hat die Branche Probleme, qualifizierte Ingenieure zu rekrutieren. Vor allem fehlen Metallurgen und Werkstoffwissenschaftler. Absolventen aus Physik, Chemie, Maschinen- und Fahrzeugbau sind ebenfalls willkommen.
“Mein Wissen als Chemikerin ist hier täglich gefragt”, sagt Dr. Kerstin Ullrich. Die 35jährige hat im Bereich Festkörperchemie promoviert und forschte danach an einem Bremerhavener Institut für polare Meeresforschung. Anfang 2002 wechselte sie zur Salzgitter AG, wo sie heute Konzepte und Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Stahl entwickelt.
Beileibe keine typische Karriere. Vor ihrem Wechsel hatte Ullrich keine Berührungspunkte zum Werkstoff Stahl. Erst eine frühere Studienkollegin wies sie darauf hin, dass die Branche auch Chemiker sucht. “Interessant”, fand sie und schickte eine Bewerbungsmappe an Salzgitter. Es folgte eine angenehme Überraschung. Das Unternehmen lud sie zum unverbindlichen Gespräch ein und bot ihr die Gelegenheit, sich einmal umzuschauen. “Ich konnte mir in Ruhe ein Bild machen, ob das hier etwas für mich ist”, erinnert sie sich.

Ullrich arbeitet heute in der Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH. In sechs Abteilungen gehen hier 270 Mitarbeiter dem Werkstoff Stahl auf den Grund. Teils entwickeln sie neue Legierungen und Anwendungen, teils entwerfen sie effiziente Herstellungsprozesse. Dritte prüfen und charakterisieren die Stähle, wieder andere feilen an Füge- und Umformverfahren. Im Fokus stehen stets die Kunden mit ihren spezifischen Anforderungen an das Material.
Die Forschungs- und Entwicklungsingenieure sind zugleich Berater. Sie wissen um die Qualitäten der Werkstoffe und die Tücken ihrer Bearbeitung. Dieses Wissen geben sie an die Kunden weiter. Ullrichs Metier ist die Oberflächentechnik. In Teams mit Werkstoffwissenschaftlern, Ingenieuren und anderen Chemikern entwickelt sie Schutz- und Veredelungskonzepte für Stahloberflächen. “Im Grunde geht es um alle erdenklichen Beschichtungsprozesse und die nötige Vorbehandlung”, erklärt sie und gibt ein Beispiel: Bleche für Waschmaschinen liefern Stahlkonzerne heute weiß aus. Die Lacke sind so robust, dass sie das spätere Zuschneiden und Umformen der Bleche schadlos überstehen. Dass dafür einiges an Forschung und Entwicklung nötig war, leuchtet ein.

Natürlich entwickelt Salzgitter keine Lacke. Doch Ullrich und ihre Kollegen sondieren, was Kunden verschiedener Branchen von Stahlerzeugnissen wünschen. Und sie behalten im Auge, welche neuen Verfahren der Markt bietet. Ullrich ist auf chemische Oberflächenbehandlung spezialisiert. Sie macht sich Gedanken, wie man Stahl für den Transport zum Kunden vorübergehend vor Korrosion schützen kann oder entwickelt Verfahren zur chemischen Vorbehandlung vor dem Lackieren. Bei den fälligen Labortests ist ihr chemisches Wissen gefragt. Denn erst die exakte Analyse der Experimente bringt die Entwickler voran. Warum schützt eine Substanz die eine Legierung besser vor Witterungseinflüssen als andere? Wie bringt man Lack dazu, auf verzinkten Oberflächen zu haften? Auch wenn die Politik den Gebrauch chemischer Zusätze verbietet, sind die Chemiker gefragt. Aktuell forscht Ullrich nach Ersatzstoffen für Chrom VI, das ab Juli 2006 im Elektro- und Haushaltsgerätebereich Tabu ist. Und häufig geht es auch darum, ganz neue Ideen zu realisieren - etwa antimikrobielle oder Antifingerprint-Beschichtungen.
Neben fundiertem Fachwissen ist in der Stahlbranche Offenheit gefragt. Denn in den Forschungs- & Entwicklungsabteilungen ziehen Spezialisten verschiedenster Disziplinen an einem Strang. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat die Branche ihre Ingenieurquote verdreifacht. Angesichts des Wettbewerbs um die besten Prozesse, Werkstoffe und Produkte rechnen Branchenkenner mit steigendem Bedarf an Ingenieuren. Doch die Stahlindustrie kann ihren Personalbedarf schon jetzt nicht decken. Das gilt besonders für Metallurgen, von denen es kaum halb so viele gibt, wie die Unternehmen bräuchten. Wer in Metallurgie abschließt, hat in der Regel schon beim Examen den ersten Arbeitsvertrag in der Tasche. (Quelle: Frankfurter Allgemeine Hochschulanzeiger, Ausgabe 81, Nov. 2005)